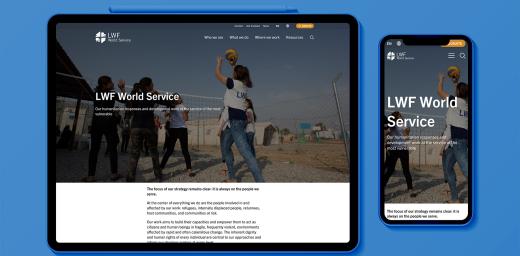„Gelten wir als neutral?”

Verbrannte Häuser in Bor, Südsudan, einem der Einsatzgebietendes LWB. Foto: Paul Jeffrey
Gespräch mit LWB-Sicherheitsberaterin Susan Muis
Das Erdbeben in Nepal, Autodiebstahl, Kidnapping und Gefangennahmen – in den vergangenen sechs Monaten waren die MitarbeiterInnen des LWB mit zahlreichen kritischen Situationen konfrontiert. Susan Muis, Programmreferentin für Zentralafrika und neu ernannte Sicherheitsberaterin für den Lutherischen Weltbund (LWB), spricht darüber, wie die zunehmende Unsicherheit die humanitäre Arbeit verändert hat und wie wichtig eine gute Vorbereitung und die Betreuung des Personals sind.
Lutherische Weltinformation (LWI): Wie hat sich aus Ihrer Erfahrung das Arbeitsumfeld für Hilfsorganisationen in den vergangenen Jahren verändert?
Susan Muis: Es hat sich grundlegend verändert. Die humanitären Grundsätze der Unparteilichkeit und Neutralität werden in bestimmten Kontexten inzwischen heftig in Frage gestellt. Wir müssen uns inzwischen fragen: Werden wir als neutral angesehen? Ein Wendepunkt war der Angriff auf die Vereinten Nationen in Bagdad im Jahre 2003. An diesem Tag wurde klar, dass die Vereinten Nationen von bestimmten Parteien nicht als unparteiisch angesehen wurden. Vor 20 Jahren konnten Hilfsorganisationen problemlos humanitäre Hilfe leisten, solange sie gute Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und örtlichen Führern gepflegt haben. Inzwischen sind diese MitarbeiterInnen zu einem „weichen Ziel“ von Kriminellen geworden, da sie nicht bewaffnet sind und ihre Laptops und Mobiltelefone Begehrlichkeiten wecken. Wenn man sich die Statistik ansieht, wird deutlich, dass besonders die landeseigenen MitarbeiterInnen höheren Risiken ausgesetzt sind.
Wodurch wird die Situation für die einheimischen HelferInnen kritischer?
Die aus der Statistik ist teilweise der Tatsache geschuldet, dass Organisationen in zunehmend in Strukturen und Kapazitäten vor Ort investieren und deshalb mehr einheimisches Personal einstellen. Deshalb gibt es mehr nationale als internationale MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen. Das einheimische Personal ist aber möglicherweise durch seine Verbindung zu einer (ausländischen) Hilfsorganisationen eher in Gefahr. Zusätzliche Risiken können sich aufgrund ethnischer Zugehörigkeit oder des Geschlechts ergeben.
Die einheimischen Teams arbeiten oft eng mit der lokalen Bevölkerung in den Krisenregionen. Im Südsudan wurde die Situation für unsere MitarbeiterInnen sehr bedrohlich, als ein Flüchtlingslager auf einmal von Rebellen umzingelt war. Da es sich um einen Konflikt ethnischer Prägung handelt, bedeutet dies eine besondere Bedrohung für Personal bestimmter ethnischer Gruppen. In solchen Situationen versetzen wir unsere nationalen MitarbeiterInnen in andere Landesteile. Das erfordert eine Menge Flexibilität und Stresstoleranz seitens der Betroffenen.
Welche Situationen haben Ihrer Meinung nach das höchste Gefahrenpotenzial?
Nach meiner Erfahrung sind die MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen am gefährdetsten, wenn sie auf den Strassen unterwegs sind, das entspricht auch den Erkenntnissen des Aid Workers Report 2014. Sie sind dann leichte Ziele für Angriffe aus dem Hinterhalt oder vom Strassenrand aus.
In den vergangenen sechs Monaten hat es beim LWB auch Zwischenfälle gegeben, bei denen MitarbeiterInnen entführt und oder festgehalten wurden, ja sogar auf sie geschossen wurde. Weltweit hat die Zahl der Konflikte und der humanitären Katastrophen dramatisch zugenommen. Wir können nicht überall Hilfe leisten, aber wir versuchen, die Menschen so gut zu unterstützen wie wir können. Wir wissen, dass wir viel von unseren MitarbeiterInnen und Kirchen verlangen, denn um in Not geratenen Menschen in gefährlichen Regionen zu helfen, nehmen sie oft erhebliche Risiken auf sich.
Wie können wir diese Risiken minimieren?
Eine unserer Strategien zur Risikobegrenzung ist die so genannte Akzeptanzstrategie. Wir arbeiten mit lokalen Strukturen, Kirchen und anderen Stellen zusammen, die eng mit den Gemeinschaften vor Ort verbunden sind. Wenn das Team vor Ort akzeptiert ist, erfahren die Mitglieder von der örtlichen Bevölkerung schneller, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Die verstecken unsere MitarbeiterInnen dann auch, wenn bewaffnete Gruppen ins Dorf kommen.
Akzeptanz reicht aber heute nicht mehr aus, deshalb beginnen immer mehr Organisationen wie der LWB damit, Schutzmechanismen für das Personal und Ausrüstung einzurichten. Das beinhaltet den Zugang zu örtlichen Sicherheitsnetzen, Sicherheitsschulungen für Personal vor Ort, Strategien, Pläne und Verfahren für mehr Schutz und Sicherheit und Wachposten vor den Büros im Einsatzgebiet. Trotzdem versuchen wir weiterhin alles, um unserem Anspruch der Direkthilfe im unmittelbaren Kontakt mit den Menschen vor Ort gerecht zu werden. Wir wollen uns nicht abschotten.
Welchen Einfluss hat diese Arbeitsumgebung auf das Personal?
Der LWB arbeitet in zahlreichen Hochrisikoländern, in denen sich die Sicherheitslage schnell ändern kann – z.B. in der Zentralafrikanischen Republik, im Südsudan, im Tschad, in der Demokratischen Republik Kongo, in Burudi, Kenia, Irak und Kolumbien. In den meisten dieser Länder haben wir eine komplexe Konfliktsituation mit zahlreichen Parteien und Rebellengruppen, die das Arbeitsumfeld sehr anstrengend, weil unberechenbar machen. Wir wissen, dass diese schnell veränderliche Lage unserem Personal, den Geldgebern und den HilfeempfängerInnen eine Menge abverlangt. Ich habe hohen Respekt vor Menschen, die unter diesem konstanten Druck arbeiten.
Vor vier Monaten haben die LWB-MitarbeiterInnen in Nepal eine Naturkatastrophe erlebt. Mit welchen speziellen Risiken müssen die Leute vor Ort umgehen?
Nach einer Naturkatastrophe müssen man mit Plünderungen und gewalttätigen Übergriffen rechnen. Das war nach dem Erdbeben auf Haiti der Fall. Unser Personal in Nepal hat ebenfalls kritische Situationen erlebt, in denen vom Erdbeben Betroffene die Hilfsgüter stehlen wollten. Die meisten Sicherheitsrisiken sind in Nepal jedoch durch die Nachbeben und Erdrutsche entstanden. Nach dem grossen Erdbeben am 25. April gab es mehr als 50 Nachbeben, einige davor sehr stark. Daraus entstehen nicht nur erneut gefährliche Situationen wie zusammenstürzende Gebäude. Diese Nachbeben haben auch emotional erhebliche Auswirkungen. Ein Erdbeben kann eine sehr traumatische Erfahrung sein, und diese Erinnerungen kommen bei jedem Nachbeben zurück.
In Nepal waren viele Mitglieder unseres Teams und des örtlichen ACT-Forums direkt betroffen. Ihre Häuser wurden beschädigt oder sind eingestürzt, so dass sie mit ihren Familien in total überfüllten Wohnungen leben mussten. Angehörige waren verletzt, sie haben sich Sorgen gemacht über ihre Kinder oder betagte Eltern, die jetzt im Freien geschlafen haben. Trotzdem haben sie sehr viel Engagement und Einsatzbereitschaft gezeigt und waren jeden Tag und auch an den Wochenenden im Büro, um anderen zu helfen.
Wir wurden die MitarbeiterInnen in dieser Situation unterstützt?
Menschen gehen auf unterschiedliche Weise mit lebensbedrohlichen Krisensituationen um. Die einen werden sehr aktiv und verarbeiten ihr eigenes Trauma, indem sie anderen helfen und die Arbeit fast therapeutisch nutzen. Andere sind ängstlich und passiv und neigen zu psychologischen Problemen wie Depressionen, Schlaflosigkeit und posttraumatischen Belastungsstörungen. In beiden Fällen brauchen sie Hilfe, und wir nehmen das sehr ernst.
In Nepal hat das ACT-Nepalforum abgesehen von der materiellen Unterstützung unseres Teams mit Notunterkünften und Hilfe beim Wiederaufbau einen Sicherheitsbeauftragten eingestellt, der vor dem Antritt von Reisen die Betroffenen instruiert und Sicherheits- und Schutzanleitungen ausarbeitet. Kurz nach dem Erdbeben wurde ein Psychologenteam zur Unterstützung des dortigen Personals nach Nepal geschickt. Diese „Nachsorge“ ist für den Bewältigungsprozess extrem wichtig. Die MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen sind sehr engagiert, sie identifizieren sich stark mit ihrer Arbeit. Wenn Sie in belastende Situationen geraten ist es unsere Pflicht, sie auf jede mögliche Weise zu unterstützen.